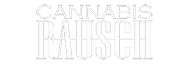Eines der größten Konfliktpotentiale fortgeschrittener Eltern-Kind-Beziehungen ist wohl das Thema Drogen. Zum einen bedingt durch den teilweise unerfahrenen Umgang von Eltern mit anderen Drogen als Alkohol und Tabak, zum anderen durch die Schwierigkeit, die richtige Art der Kommunikation zu finden. Das Thema ist sehr sensibel und birgt zu allem Überfluss noch sehr viele Risiken. Dabei ist es jedoch keinem Jugendlichen zu verdenken, sich mit dem Thema Drogen auf selbstexperimentelle Art zu beschäftigen. Die Neugier ist spätestens ab dem Punkt geweckt, an dem Freunde über Drogen reden oder ihrerseits erste Erfahrungen gemacht haben oder wenn das stets wohl behütete Kind womöglich direkt von einem Dealer angesprochen wird.
Alles keine schönen Szenarien, wenn man bedenkt, welche Folgen frühzeitiger Drogenkonsum mit sich ziehen kann, doch auf der anderen Seite ist der Kinder-ansprechende Schwarzmarktdealer oder dealende Mitschüler in unserer repressiven Drogengesetzgebung tägliche Realität. Wir müssen also gar nicht mehr eruieren, ob Jugendliche tendenziell zum Kiffen kommen – denn es wird sowieso früher oder später passieren. Das beste wäre also, sich als Eltern frühzeitig mit dem Thema Drogen zu beschäftigen, weniger risikobehaftete von stärker risikobehafteten Drogen abzugrenzen und sich konkret darüber Gedanken zu machen, wie man mit einem möglichen Drogenkonsum der eigenen Kinder umzugehen vermag. Falls man das noch nicht getan hat und auch sonst vielleicht nicht den engsten Zugang zu seinem Kind hat, stellt sich vor allem erstmal eine Frage:
Wie merke ich, dass mein Kind kifft?
Die zwischenmenschlich angenehmste Lösung wäre theoretisch ein Gespräch. Dabei wird jedoch nicht berücksichtigt, dass sich Kinder in der Pubertät zunehmend von den Eltern abzugrenzen versuchen, immerhin wollen sie perspektivisch eine eigene Linie für ihr Leben finden und ihren eigenen Charakter formen. Klar, dass in dieser Zeit Ausprobieren, Protestieren und Ablehnen wichtige Instrumente der eigenen Persönlichkeitsentwicklung werden. Jugendliche werden in dieser Zeit unheimlich neugierig, suchen den Input und wollen Grenzen ausloten und erweitern. Drogen wie Cannabis, Marijuana, Haschisch oder auch Weed, wie die konsumierbaren Produkte der Cannabis Sativa L. unter anderem heißen, sind dabei sehr beliebt: Immerhin 8,7% der deutschen Jugendlichen nahmen in ihrem Leben laut Bundesdrogenbericht 2018, welcher sich auf Zahlen des „Alkoholsurvey 2016“ beruft, schon mindestens einmal Cannabis zu sich. Und das gilt lediglich für die 12-17-Jährigen! 6,9% der Jugendlichen dieser Altersgruppe hat in den letzten Jahren mindestens einmal gekifft, 1,5% pflegen einen regelmäßigen Cannabis-Konsum.
Klar dürfte allerdings auch sein, dass diese Zahlen aus Gründen der Befangenheit und Angst vor Repression der Jugendlichen nicht allzu aussagekräftig sein dürften: Die tatsächliche Zahl an jugendlichen Konsumenten ist mit Blick auf eine durchschnittliche deutsche Schule wohl viel höher. Auch wenn Eltern das ungern hören: Kiffen gehört in bestimmten Städten und Vierteln mittlerweile einfach dazu. Privilegierte Viertel und Schulen seien dabei nicht ausgenommen, dort wird auf Grund des höheren Taschengelds der Kinder sogar tendenziell mehr konsumiert als an mutmaßlichen Problemschulen. Strenge Urinkontrollen an Internaten sprechen da eine eindeutige Sprache und belegen die immensen Probleme von Eltern und Lehrkräften mit experimentierfreudigen Schülern. Wer THC-positiv getestet wird, fliegt.
Welche Merkmale zeigen mir, dass mein Kind kifft?
Es gibt augenscheinliche und weniger augenscheinliche Indizien dafür, dass dein Kind oder sogar mehrere davon kiffen. Erschwerend kommt hinzu, dass Indizien keine Beweise und deshalb nicht eindeutig belastend sind. Mögliche Anzeichen, dass dein Kind kifft, können sein:
- Gerötete Augen
- Heißhungerattacken zu ungewöhnlichen Uhrzeiten
- Rauchutensilien oder Tabak tauchen auf
- Plötzlicher Einbruch von Lernerfolgen
- Chronischer Geldmangel
Alle fünf genannten Indizien sprechen für sich genommen noch nicht unbedingt für Cannabis-Konsum. Dementsprechend sollte man sich mit direkten Anschuldigungen als Folge einer Beobachtung eines der Indizien zurückhalten und allenfalls aus einer defensiven, forschenden Haltung das Gespräch suchen. Denn rote Augen können auch allergiebedingt auftauchen oder der Schützling hat gerade „nur“ eine schwere Zeit und musste sich an einer elternfremden Schulter unter Tränen die Gefühle von der Seele reden. Gerade bei letzterem Fall wäre es fatal, mit einem Konsumvorwurf um die Ecke zu kommen, anstatt die eigentlichen Sorgen zu erkennen.
Auch Heißhungerattacken müssen natürlich nicht fürs Kiffen sprechen – aber wenn Kind abends spät nach Hause kommt und sich das erste Mal selbstständig was kocht, bestellt oder einfach nur die Brotmaschine bedient, ist das schon verdächtig. Wenn Kind dann noch direkt nach dem nach Hause kommen sich erstmal die Hände wäscht und Zähne putzt, um sich verdächtiger Gerüche zu entledigen, kann man schon mal vorsichtig fragen, wie es denn zu dem plötzlichen Lebenswandel kommt – denn wann hat Kind in der Vergangenheit schon einmal Wert auf Hygiene gelegt oder sich ohne Zutun der Eltern etwas zu essen gemacht?
Sehr verdächtig kann auch das Auftauchen von Rauchutensilien oder Tabak sein.
Klar, man sollte das Vertrauen zum Kind nicht missbrauchen, indem man Chatverläufe oder Jackentaschen kontrolliert – aber irgendwann stolpert man dann doch irgendwann über die Utensilien, schließlich wiegen sich Kinder mit der Zeit immer mehr in Sicherheit und legen weniger Wert auf Risikomanagement. Da Jugendliche tendenziell eher wenig Geld haben, mischen sie oft Gras mit Tabak. Denn nicht jeder mag auch normal rauchen. Wenn dann statt Zigarettenpapieren noch extra lange Drehpapiere und sogenannte Tip-Blocks auftauchen, welche als Filterersatz fungieren, ist das Indiz schon ziemlich stark. Doch egal ob nur Rauchen oder Cannabis-Konsum: In beiden Fällen ist es angeraten, das Gespräch zu seinen Kindern zu suchen – denn Tabak macht leider verdammt abhängig.
Wenn dein Kind immer gut in der Schule war und mit der Zeit immer mehr das Interesse am Lernen verliert, kann das die unterschiedlichsten Ursachen haben: Entweder fühlt sich dein Kind irgendwann nicht mehr dazu berufen, sich dem System zu stark zu beugen. Oder dein Kind fängt eine Liebesbeziehung an und hat im Moment einfach keinen Kopf für binomische Formeln und kartesische Produkte. Oder sieht sich einfach nicht mehr dem lebensnahen Unterrichtsstoff aus der vierten Klasse gegenübergestellt. Doch es kann auch sein, dass die Kifferei immer mehr Zeit beansprucht, weil Cannabis sich besser zum Zeit totschlagen eignet als sich näherungsweise der avogadrischen Zahl zu nähern. Kiffen macht einfach mehr Spaß als Hausaufgaben und auch im Vergleich zu Sport führt Kiffen anstrengungsärmer zu Erfolgen. Wobei Erfolg hier lediglich für einen Zustand des Glücklichseins steht.
Zeit totschlagen scheint für viele Jugendliche heutzutage sehr wichtig – denn im Vergleich zu früheren Generationen leben Kinder heutzutage einfach von der Hand in den Mund und haben neben sporadischem Geschirrspülmaschine-ausräumen eher weniger Pflichten. Als Eltern hat man es dementsprechend geschafft, wenn Kind erst mit Beginn der ersten Ausbildung oder Studium mit dem Kiffen anfängt – so kommen sie gar nicht erst in den lethargischen Trott, der sich wohl oder übel einschleicht, wenn man keine Verpflichtungen und viel zu viel Freizeit hat. Übrigens kann an der Stelle auch ein plötzliches Aufhören mit sportlichen Aktivitäten ein Anzeichen für preadulte Kifferei sein – an der Stelle hat Kind dann wahrscheinlich begriffen, dass sich durch Kiffen ähnliche Glücksgefühle erreichen lassen wie beim Fußballspielen. Dopamin kann man letzten Endes durch viel zu viele Substanzen und Aktivitäten erreichen – Sport und Kiffen sind da nur zwei Beispiele unter vielen.
Wenn dein Kind viel kifft, ist es wahrscheinlich chronisch pleite.
Wenn dein Kind unter chronischem Geldmangel leidet und vielleicht sogar zu drastischen Aufstock-Methoden wie klauen greift, herrscht Alarmstufe rot. Egal, ob gekifft wird oder nicht. An der Stelle findet einfach ein immenser Vertrauensbruch statt. In jedem Fall sollte man also bei solch einer Beobachtung das Gespräch mit seinem Kind suchen und die Ursachen eruieren. Da Gras sogar noch teurer als Yu-Gi-Oh-Karten ist, wobei für die Sammelkarten wahrscheinlich in deutlich früheren Entwicklungsstadien Geld benötigt wurde, sind die für den Konsum nötigen Summen entsprechend hoch: Auf dem Schwarzmarkt werden im Schnitt 10 EUR pro Gramm Cannabis-Blüten oder –Hasch verlangt. Ein Gramm ist dabei schneller weggeraucht als man bis 420 zählen kann. Vor allem bei regelmäßigem Konsum besteht somit schnell ein Bedarf von mehreren hundert Euros pro Monat. Auch hier zeigt sich wieder: Kinder und Jugendliche, die beispielsweise auf Grund der komfortablen Einkommenssituation der Eltern schon immer die Summen bekamen, die sie wollten, werden beim Thema Drogen besonders konsumfreudig und kurbeln somit die Konjunktur des örtlichen Cannabis-Schwarzmarktes ordentlich an. Papa zahlt ja schließlich.
Kommen viele der eben genannten Merkmale zusammen, kann man mit höherer Sicherheit auf einen möglichen Cannabis-Konsum seiner Kinder schließen, als wenn nur eine oder zwei Beobachtungen auftreten. Ansonsten empfiehlt sich eine gute Menschenkenntnis. Wer schon immer einen guten Draht zu seinen Kindern hat, wird wahrscheinlich gar nicht erst in die Gelegenheit kommen, seine Kinder erst Wochen oder Monate nach dem ersten Konsum in flagranti beim oder nach dem Konsum zu erwischen. Wer seine Kinder gut kennt, aber ausgerechnet Drogen für ein ewiges Tabuthema hält, wird sicherlich am Verhalten, neuen Problemen, Stimmungen oder auch Schwierigkeiten bei der Artikulation drogenferner Themen Veränderungen spüren. Cannabis schwächt die Gedächtnisleistung, wirkt sich negativ auf das Sprachzentrum aus (Stichwort Wortfindungsstörung) und macht unkonzentriert. Fahrigkeit im Alltag, verpasste Termine oder chronische Null-Bock-Stimmung (wenn nüchtern) können also ebenso Anzeichen dafür sein, dass dein Zögling dann und wann zur Sportzigarette greift.
Was kann ich tun, wenn mein Kind kifft?
Wenn du den unangenehmen Punkt der Entdeckung bewusstseinserweiterter Vorlieben deiner Kinder oder deines Kindes überwunden hast, gehen die wirklich existenziellen Fragen erst richtig los: Wie geht man jetzt damit um? Konsequentes Verbot und gut ist? So einfach ist die Sache in der Realität leider nicht. Denn es finden sich immer Gelegenheiten, um heimlich einen durchzuziehen. Manchmal bis oft kifft auch der gesamte Freundeskreis und dein Kind wäre – bei allem Unverständnis – erstmal sozial isoliert.
Ohne eine übermächtige Eltern-Allianz und durchgehende Überwachung ist es also verdammt schwierig, seinem Kind das Kiffen zu verbieten. Auch Taschengeld streichen bringt nicht unbedingt den gewünschten Effekt – am Ende wird beim Kumpel angebaut. Denn dessen Eltern haben vielleicht selber schon oft gekifft und teilen die Vorbehalte anderer Eltern nicht. Oder es kauft sowieso immer der wohlhabende Unternehmersohn oder die Tochter des Richters in der Klasse die duftenden und berauschenden Blüten für alle. Soziale Akzeptanz lässt sich unter all den mittellosen Schülern mit Geld oder wertvollen Drogen einfacher erkaufen, als wenn man einfach immer nett und freundlich ist. Kapitalismus beginnt nicht erst mit Aufnahme des BWL-Studiums!
Leider schadet kiffen der Gehirn-Entwicklung junger Menschen teilweise immens. Während zum Zeitpunkt des Rausches die Leistung des Kurzzeitgedächtnisses recht deutlich eingeschränkt wird, manchmal weiß man nicht mehr, was man vor fünf Minuten noch gesagt hat, ergeben sich auch bei langanhaltendem oder täglichem Konsum gewisse Folgen für das Gehirn. So haben Studien gezeigt, dass tägliches Kiffen die Konzentration hemmt und strukturierte Informationen, wie sie in der Schule zum Großteil gefordert sind zu Lernen, weniger effizient aufgenommen werden können.
Frühzeitiges und zu häufiges Kiffen verhindert eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung.
Doch auch darüber hinaus stellt das frühzeitige – und vor allem dauerhafte – Kiffen eine Belastung für die eigene persönliche Entwicklung dar. Während ihrer Entwicklung machen Kinder und Jugendliche harte Phasen durch, müssen Rückschläge hinnehmen, lernen zu verlieren oder haben abgöttischen Liebeskummer. Da als Folge des Cannabis-Konsums im Körper jede Menge Dopamin freigesetzt wird, was gleichermaßen Stress reduziert und Glück induziert, lernen Kinder somit nicht, mit solchen Stresssituationen auch ohne Hilfe der Drogen fertig zu werden. Und wenn sie jetzt schon nicht anders mit dem vergleichsweise geringen Stress fertig werden – wie sollen sie erst später im Studium, Job oder der eigenen Familienplanung ohne Cannabis klar kommen? Der Körper muss sich an psychische Belastungen gewöhnen – und nicht an ein Leben im Rausch.
Das solltest du also unternehmen, wenn du merkst, dass dein Kind kifft:
Informiere dich – vielleicht sogar auf unserer Seite – über das Thema. Intensiv. Nichts ist peinlicher, als sich von seinem Kind unentwegt berichtigen lassen zu müssen, während man eigentlich ein sehr sensibles Thema besprechen möchte. Das endet dann womöglich in Streit, energisch geschrienen Vorwürfen und lösungsfernen Schuldzuweisungen. Lieber damit rechnen, dass sich das eigene Kind über das Thema informiert hat – und wenn nicht, kann man in dem Moment ja nur von seinem (Fach)wissen profitieren, um Gefahren und Risiken des Kiffens besser darlegen zu können. Ziel sollte eine für beide Parteien zufriedenstellende Lösung sein – das kann beispielsweise bedeuten, dass nur am Wochenende gekifft wird. Oder dass wer kifft, auch Sport treiben sollte. Oder eine monatliche Ausgabegrenze für Gras festgelegt wird.
Es mag komisch erscheinen, solche Kompromisse einzugehen, ohne sich näher mit der Thematik weiter auseinandergesetzt zu haben. Doch Cannabis gehört heute einfach mit zur Pop-Kultur – und dessen Zielgruppe sind nun einmal zum großen Teil Jugendliche. Sie wachsen heutzutage mit Cannabis auf – in den Medien, in der Musik, besonders im Rap, durch Instagram, Facebook oder YouTube. Cannabis ist mittlerweile überall – ein vollständiges Verbot erscheint deshalb für viele Jugendliche nicht gerechtfertigt. Deshalb ist das Drogen-Gespräch mit dem eigenen Kind knallharte Politik: Man muss den Kompromiss schaffen, den Konsum der Kinder so weit wie möglich zurückzufahren, dabei jedoch die Kinder nicht komplett zu verlieren bzw. die elterliche Meinung nicht zählen zu lassen. Dann hat man gar nichts gekonnt.